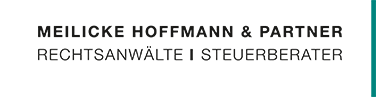Newsletter
BGH betont mal wieder Treuepflicht der Gesellschafter – Kein Vertrauen in Bestand von durch rechtswidrige Beschlüsse geschaffene Verhältnisse auch nach vielen Jahren – Ausschluss aus Gesellschaft ultima ratio
In einer hinsichtlich des Sachverhalts etwas verästelten Entscheidung zur Klage gegen Beschlüsse einer Gesellschafterversammlung einer GmbH & Co. KG hat der BGH einmal mehr die Bedeutung der Treuepflicht herausgearbeitet. Gesellschafter müssten gegenüber den einzelnen Mitgesellschaftern bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen an der Beteiligung an der Gesellschaft auf die Belange der Mitgesellschafter Rücksicht zu nehmen; einem Gesellschafter könne ein eigener Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Treuepflicht gegen den pflichtwidrig handelnden Gesellschafter zustehen, wenn ihm persönlich ein Schaden entstanden ist, der über die Entwertung seiner Mitgliedschaft durch Schädigung der Gesellschaft hinausgeht.
Worum ging es in dem Fall?
Die Prozessparteien waren Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft, einer Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Klägerin hielt die Hälfte der Anteile, die Beklagten zu 1 bis 3 den Rest, jeweils 1/6. Nach dem Gesellschaftsvertrag genügte für Gesellschafterbeschlüsse die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht zumal zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Mehrheit verlangen. Kommanditisten konnten dem Vertrag aus der KG durch Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen werden, wenn in ihrer Person ein wichtiger Grund vorliegt; dazu zählte insbesondere der nachhaltige grobe Verstoß gegen wesentliche Gesellschafterpflichten. Im Prozess ging es um eine Gesellschafterversammlung im Jahr 2016. Die beschloss (allein) mit den Stimmen der Beklagten den Ausschluss der Klägerin aus der KG denn sie habe als KG-Geschäftsführerin grob gegen ihre Pflichten zu ordnungsgemäßer Geschäftsführung verstoßen. Die Klägerin hatte zwar gegen den Beschluss gestimmt; ihre Stimmen wurden wegen Selbstbetroffenheit nicht mitgezählt, sie sei vom Stimmrecht ausgeschlossen.
Die Klägerin klagte gegen den Ausschließungsbeschluss. Das Landgericht (Wuppertal) stellte in seinem Urteil im Jahr 2020 die Nichtigkeit des Ausschließungsbeschlusses fest. Dagegen gingen die Beklagten in die Berufung. Während des Berufungsverfahrens ist die KG in eine GmbH umgewandelt worden; an der waren nach der zum Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste nur noch die Beklagten beteiligt, die hatten die Klägerin nicht an der Beschlussfassung zur Umwandlung mitwirken lassen mit dem (Schein-)Argument, die Klägerin sei nicht mehr an der KG beteilgt. Das Oberlandesgericht (Düsseldorf) bestätigte im Berufungsurteil 2023 die Nichtigkeit des Ausschließungsbeschlusses und verurteilte einen der Beklagten, der Kläger alle aufgrund des Ausschließungsbeschlusses und seiner Umsetzung entstandenen und noch entstehenden Schäden zu ersetzen. Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten.
Entscheidung des BGH
Der BGH-Gesellschaftsrechtssenat hat die Revision (soweit hier von Bedeutung) als nicht begründet zurückgewiesen (Urteil vom 10. Dezember 2024 – Aktenzeichen II ZR 37/23. den Antrag zu Recht für zulässig erachtet.
Zu Beginn seiner Entscheidung stellt der BGH eine prozessuale Frage (zutreffend) klar und bewegt sich damit auf rechtlich gesichertem Terrain: Für den Streit um die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung der KG-Gesellschafterversammlung 2016 gilt noch das bis 2023 geltende Beschlussmängelrecht vor der grundlegenden Reform durch das 2024 in Kraft getretene MoPeG – das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (vgl. Newsletter 8/2021).
Für vergleichbare Fälle wichtig ist ein weiterer Schritt des Urteils: Der Formwechsel der Gesellschaft von der Rechtsform der KG in die GmbH lässt das Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht entfallen und lässt ihre Klage nicht etwa unbegründet werden. Dem steht nach dem BGH die im Umwandlungsgesetz angeordnete Irreversibilität der Umwandlung nicht entgegen (§ 202 Abs. 3 UmwG). Diese beschränke sich auf die Umwandlung als solche, dh es gebe im Grundsatz kein Zurück in die KG. Die Irreversibilität erfasse aber nicht andere Beschlüsse, die gemeinsam mit oder vor der Umwandlung gefasst wurden – falls sie nicht ausnahmsweise eine notwendige Grundlage der Umwandlung sind. Das sei bei dem mehrere Jahre vor der Umwandlung gefassten Ausschließungsbeschluss nicht der Fall. Der BGH unterstreicht, dass gerade auch bei unangreifbarer, bestandskräftiger Umwandlung als solcher dem zu Unrecht ausgeschlossenen Gesellschafter ein Schadensersatzanspruch des betroffenen Gesellschafters in Betracht kommt; der umfasse auch Ersatzansprüche wegen der nicht der ordnungsgemäßen Bestimmung von Anteilen und Mitgliedschaften an der Gesellschaft in neuer Rechtsform.
Schließlich bestätigt der BGH die Sicht des Oberlandesgerichts, dass der Ausschließungsbeschluss nichtig war. Es habe erachtet. Es habe nämlich kein wichtiger Grund für die Ausschließung vorgelegen: Der setze voraus, dass die Fortsetzung der Gesellschaft mit dem Auszuschließenden für die übrigen Gesellschafter unzumutbar ist. Das Urteil hierüber erfordere eine umfassende Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände des Einzelfalls; die erforderliche Gesamtabwägung müsse den Interessen beider Seiten gerecht werden. Art und Schwere des Fehlverhaltens des Auszuschließenden seien ebenso zu berücksichtigen wie ein etwaiges Fehlverhalten der den Ausschluss betreibenden Gesellschafter. Die Ausschließung sei "ultima ratio", die Unzumutbarkeit dürfe nicht durch mildere Mittel beseitigt werden können.
Mit solchen Einzelheiten befasst sich der BGH dann näher – worauf hier nicht eingegangen werden soll. Interessant über den Fall hinaus ist, was er zu zwei Vorwurf sagt: Zum einen war der Klägerin Fehlverhalten als Geschäftsführerin vorgeworfen worden. Die Möglichkeit solcher Vorwurf relativiert der BGH deutlich: Bei Vorwürfen wegen Unzulänglichkeiten in der Geschäftsführung sei grundsätzlich als mildere Maßnahme vor einem Ausschluss vorrangig die Bestellung eines anderen Geschäftsführers in Betracht zu ziehen. Zum anderen misst der BGH dem Vorwurf keine ausschlaggebende Bedeutung zu, dass die Klägerin hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft andere Ausfassungen vertreten habe als die anderen Gesellschafter und einem Finanz- und Investitionsplan nicht zugestimmt habe; denn Gesellschafter (einer Personengesellschaft) seien nach der ständigen Rechtsprechung in der Ausübung ihres Stimmrechts grundsätzlich frei; die Treuepflicht verpflichte zur Zustimmung zu von den übrigen Gesellschaftern gewünschten Maßnahme nur, wenn diese „zur Erhaltung wesentlicher Werte, die die Gesellschafter geschaffen haben, oder zur Vermeidung erheblicher Verluste, die die Gesellschaft bzw. die Gesellschafter erleiden könnten, objektiv unabweisbar erforderlich und den Gesellschaftern unter Berücksichtigung ihrer eigenen schutzwürdigen Belange zumutbar ist“; Gesellschaftszweck und Interesse der Gesellschaft müssten „gerade diese Maßnahme zwingend gebieten“; der dissentierende Gesellschafter müsse seine Zustimmung „ohne vertretbaren Grund verweigert“ haben. Das sind nach der Rechtsprechung hohe Anforderungen. Es sei nicht festzustellen, dass die von den anderen Gesellschaftern gewünschten Maßnahmen „alternativlos“ gewesen seien. Daher gebe es keine Stimmpflicht.
Hinsichtlich der Schadensersatzpflicht der Beklagten auf der Grundlage der BGB-Norm zur vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung (§ 826 BGB) bemerkt der BGH zunächst, der Schaden der Klägerin folge auch bei Unwirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses aus dessen Rechtsschein und vorläufigem Bestand, den sie kostenaufwändig beseitigen müsse. Eine Schädigungsabsicht der Beklagten sei nicht erforderlich, ihr Vorsatz genüge. Der könne sich aus der Art und Weise des Handelns der Beklagten als Schlussfolgerung ergeben. Sittenwidriges Vorgehen leitet der BGH dem OLG zustimmend daraus ab, dass der eine Beklagte (Geschäftsführer der Komplementär-GmbH) als Vertreter der anderen Kommanditisten und als Versammlungsleiter die Klägerin bei der Beschlussfassung vorsätzlich überrumpelt habe: Er habe deren Ausschluss „in dem Wissen herbeigeführt bzw. festgestellt, dass kein ausreichender wichtiger Grund für einen Ausschluss … vorlag, um auf diesem Weg die andernfalls nicht zu erreichende Umsetzung der von ihm gewünschten strategischen Ausrichtung der (Gesellschaft) zu erreichen“.
Hinsichtlich der weiteren beklagten Gesellschafter unterstreicht der BGH, dass Gesellschafter nicht nur gegenüber der Gesellschaft der Treuepflicht unterlägen, sondern auch gegenüber den Mitgesellschaftern. Gegenüber der Gesellschaft müssten die Gesellschafter deren Interessen wahrnehmen und geschäftsschädigende Handlungen unterlassen; gegenüber ihren einzelnen Mitgesellschaftern gebiete die Treuepflicht, auf deren Belange bei der Verfolgung der eigenen Interessen an der Beteiligung Rücksicht zu nehmen . Einem Gesellschafter könne ein eigener Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Treuepflicht gegen den treupflichtwidrig handelnden anderen Gesellschafter zustehen, wenn ihm persönlich ein über den Gesellschaftsschaden entstanden ist, d.h. ein über die Entwertung seiner Mitgliedschaft durch Schädigung der Gesellschaft hinausgehender eigener Vermögensschaden. Ob die anderen Gesellschafter nach diesem Maßstab haften, lässt der BGH das Oberlandesgericht hinsichtlich der tatsächlichen Voraussetzungen der Haftung erst mal das Oberlandesgericht weiter aufklären. Zu klären sei ua, ob sich die Beklagten ihre Vertretung durch den sittenwidrig handelnden anderen Gesellschafter und Versammlungsleiter zurechnen lassen müssten.
Einordnung der Entscheidung
Der BGH tat gut daran, Grundsätze der gesellschafterlichen Treuepflicht und der Grenzen des Ausschlusses missliebiger Gesellschafter in Erinnerung zu rufen. Ein Ausschluss aus der Gesellschaft kann immer nur eine ultima ratio sein. Man darf andere Gesellschafter bei der Beschlussfassung keinesfalls überrumpeln. Sonst drohen Schadensersatzrisiken. Nicht nur den tatsächlich handelnden Gesellschaftern und anderen Personen wie einem Versammlungsleiter. Sondern auch Gesellschaftern, die sich „nur“ haben vertreten lassen. Selbst vor der Bestandskraft von Beschlüssen macht die deliktische Haftung keinen Halt – selbst wenn die die Ausschließung betreibenden Gesellschafter zu dem Trick greifen, die Gesellschaft in eine solche anderer Rechtsform umzuwandeln. Dann kann sich der Schadensersatzanspruch darauf richten, dem ausgeschlossenen Gesellschafter im Wege des Schadensersatzes eine Beteiligung an der Gesellschaft neuer Rechtsform zu gewähren, die seiner alten Stellung entspricht. Hinzu kommen zB Ersatzansprüche für Rechtsverfolgungskosten über den prozessualen Kostenerstattungsanspruch hinaus.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 2/25
Drucken | Teilen