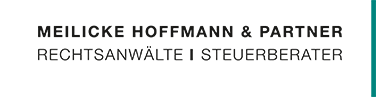Newsletter
BGH schickt Acting in Concert auf Prüfstand des Europäischen Gerichtshofs - EuGH
Immer wieder gibt es Streit um die Frage eines Stimmverbots wegen eines sog. „Acting in Concert“ (AiC)– einem Vorgehen von Aktionären, die selbst oder deren Tochterunternehmen ihr Verhalten gegenüber der Aktiengesellschaft aufgrund einer Vereinbarung „oder in sonstiger Weise“ abstimmen. Ist das so, werden nach § 34 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dem wegen der Überschreitung von Meldegrenzen (ab drei Prozent Beteiligung) meldepflichtigen Aktionär auch die Stimmrechte des Dritten zugerechnet. Meldet er seine Beteiligung nicht, unterliegt er einem umfassenden Rechtsverlust. Die Einordnung als AiC ist relativ klar, wenn es die entsprechende ausdrückliche Vereinbarung gibt. Doch kompliziert wird’s, wenn sich die Frage stellt, ob sich die Beteiligten „in sonstiger Weise“ abstimmen. Und juristisch stellt sich dann die weitere, noch grundsätzliche Frage, ob die deutsche Regelung zur „sonstigen“ Verhaltensabstimmung mit dem höherrangigen Europäischen Recht vereinbar ist. Die Entscheidung dieser Frage hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Dem steht ein Auslegungsmonopol zu.
Worum geht es in dem Fall?
Die mehreren Kläger sind Aktionäre der Beklagten. Diese ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, ihr Unternehmensgegenstand der Wertpapierhandel. Die Kläger wenden sich mit einer Anfechtungsklage gegen diverse Beschlüsse einer Hauptversammlung der Beklagten. Sie und eine weitere Aktionärin hielten im Jahr vor der Hauptversammlung zusammen mehr als 10 Prozent des Grundkapitals der Beklagten. Wären ihre Stimmrechte wegen eines AiC zusammenzuzählen gewesen, hätten sie eine Meldung über ihren Aktienbesitz abgeben müssen (§ 33 WpHG). Bei der streitgegenständlichen Hauptversammlung hielten sie zusammen nur noch weniger als 10 Prozent. Die Kläger (und die weitere Aktionärin) meldeten weder Über- noch Unterschreiten der 10 Prozent. Das Landgericht wies die Klage ab (LG Mannheim, 1. März 2021, Aktenzeichen 24 O 36/19). Die Berufung blieb erfolglos (OLG Karlsruhe, 14. November 2022, Aktenzeichen 1 U 59/21). Das begründeten die Gerichte damit, dass die Kläger nicht anfechtungsbefugt seien; sie hätten nämlich durch ihr AiC ausgelöste Mitteilungspflichten nach dem WpHG verletzt. Daher hätten ihnen keine Rechte aus ihren Aktien zugestanden – weder zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch als sie ihre Anfechtungsklage erhoben. § 44 WpHG sieht nämlich einen Rechtsverlust für Aktien vor, für die deren Inhaber Mitteilungspflichten nicht erfüllen. Das Berufungsgericht begründete das AiC aufgrund „sonstiger“ Verhaltensabstimmung mit vielen Indizien. Unter anderem hätten die Kläger und die weitere Aktionärin dieselbe Anschrift, sie ließen sich auf den Hauptversammlungen der Beklagten durch dieselben Personen mit denselben Argumenten vertreten; Gleiches gelte für eine Vielzahl von Gerichtsverfahren; sie hätten ihre Reden auf Hauptversammlungen abgestimmt, verfolgten gemeinsame Ziele bei der der Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand der Beklagten und zwischen ihnen beständen erhebliche personelle, institutionelle und wirtschaftliche Verflechtungen. Ob auch eine „Vereinbarung“ zur Stimmrechtsausübung vorlag, konnte das Berufungsgericht aus seiner Sicht konsequent offen lassen.
Der europarechtliche Hintergrund
Die Vorschrift des deutschen WpHG zu Meldepflichten der Aktionäre in börsennotierten Aktiengesellschaften beruht auf einer Richtlinie der Europäischen Union – der Richtlinie 2004/109/EG zur „Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind“ – kurz „Transparenzrichtlinie“. Die sieht in ihrem Art. 10 der Sache nach Meldepflichten bei Vereinbarungen zum AiC vor. Sie adressiert aber nicht ausdrücklich die Frage, ob (wie nach dem deutschen WpHG) die „sonstige“ Abstimmung des Aktionärsverhaltens in Hinblick auf die Aktiengesellschaft genügt. Damit stellt sich die weitere Frage: Sind strengere Regeln als die nach dem ausdrücklichem EU-Recht europarechtlich zulässig. Damit muss man auf die einschlägige Regel von Art. 3 der Transparenzrichtlinie schauen: Danach dürfen die Mitgliedstaaten hinsichtlich Meldepflichten keine strengeren Anforderungen vorsehen als die in der EU-Richtlinie festgelegten. Das Meldewesen scheint insoweit voll-harmonisiert. Wie weit das geht, ist ua vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der europäischen Regeln unklar. Für eine weite Auslegung des AiC sprechen auch parallele Regeln der dem § 30 des deutschen Übernahmegesetzes (WpÜG) zugrunde liegenden Europäischen Übernahmerichtlinie: Nach deren Art. 2 werden für die Frage, ob jemand Kontrolle über eine Aktiengesellschaft hat, dessen Aktien zusammengerechnet mit Aktien dritter Aktionäre, die mit dem Aktionär aufgrund „einer ausdrücklichen oder stillschweigenden, mündlich oder schriftlich getroffenen Vereinbarung zusammenarbeiten, um die Kontrolle über die Zielgesellschaft zu erhalten“.
Da die deutsche WpHG-Regelung auf dem EU-Recht beruht, kommt der EuGH ins Spiel. Art. 267 AEUV (der „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“, einer der zwei Gründungsverträge der EU) schreibt nämlich vor, dass der EuGH im Wege der sog. „Vorabentscheidung“ u.a. entscheidet über die Auslegung von Richtlinien der EU. Stellt sich eine solche Auslegungsfrage einem Gericht eines Mitgliedstaats und hält es eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann jedes Gericht diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegen. Stellt sich eine derartige Frage bei einem Gericht, dessen Entscheidungen (wie solche des BGH) nicht mit innerstaatlichen Rechtsmitteln angefochten werden können, so muss dieses Gericht dem EuGH die Frage vorlegen. Das sichert die einheitliche Rechtsanwendung in der EU. Der EuGH hat schon vor mehr als vier Jahrzehnten die seitdem häufig wiederholten Kriterien für die Vorlagepflicht aufgestellt: Gerichte müssen solche Fragen dem Gerichtshof vorlegen, die für den Rechtsstreit entscheidungserheblich sind und noch nicht Gegenstand einer Auslegung des EuGH waren. Die Vorlagepflicht entfällt nur in drei Fällen: (i) Zur Frage gibt es eine gesicherte Rechtsprechung des EuGH; (ii) dieser hat die Frage in einem gleichartigen Fall bereits beantwortet (acte éclairé) und (iii) die richtige Anwendung des EU-Rechts ist derart offenkundig, dass kein vernünftiger Zweifel besteht (acte clair). Kommt es unter diesen Bedingungen für die Entscheidung in einem Prozess auf die Auslegung einer europarechtlichen Norm an, ist für den BGH die Vorlage an den EuGH damit quasi „alternativlos“. Solange der EuGH mit der Entscheidung der Vorlage beschäftigt ist, ist der Prozess in Deutschland ausgesetzt. Die Entscheidung des EuGH hat Bindungswirkung für das vorlegende nationale Gericht und für alle Gerichte im ggf. nachfolgenden Instanzenzug.
Legt ein letztinstanzliches nationales Gericht entgegen den europäischen Vorgaben die Sache nicht dem EuGH vor, verstößt das gegen den Grundsatz des gesetzlichen Richters, was Verfahrensbeteiligte z.B. mit der Verfassungsbeschwerde angreifen können. Lehnt das letztinstanzliche Gericht eine beantrage Vorlage an den EuGH ab muss es in seiner Entscheidung begründen, weshalb es nicht vorgelegt hat – so jüngst erneut der EuGH in Zusammenhang mit der abgelehnten Zulassung einer Revision; die entsprechende Pflicht folge aus der Grundrechtechara der Europäischen Union (Art. 47 Abs. 2; EuGH Große Kammer, Urteil vom 15.10.2024 – C-144/23 – in einem slowenischen Fall).
Entscheidung des BGH
Der Gesellschaftsrechtssenat des BGH legte dem EuGH die Frage der Zulässigkeit der deutschen Regel des § 34 WpHG zum AiC zur Vorabentscheidung vor (Beschluss vom 22. Oktober 2024 – II ZR 193/22). Der EuGH hat nun die Frage zu beantworten, ob die o.g. Richtlinie 2004/109/EG so auszulegen ist, dass er der einschlägigen Regelung von § 34 WpHG entgegensteht – nach der für eine Zurechnung von Stimmrechten keine Vereinbarung zur Ausübung der Stimmrechte erforderlich ist, sondern ein in sonstiger Weise abgestimmtes Verhalten aufgrund faktischer Gegebenheiten reicht.
Außerdem entschied der BGH en passant eine Vorfrage seiner Vorlage an den EuGH, die auch immer wieder im Streit ist: Danach endet ein durch Verletzung von Meldepflichten eintretender Rechtsverlust nicht automatisch, wenn der Aktionär die Meldegrenze wieder unterschreitet; vielmehr muss er seine verletzte letzte Mitteilungspflicht nachträglich erfüllen.
Wie die Entscheidung des BGH einzuordnen ist
Die Entscheidung des BGH ist konsequent. Im deutschen Recht ist streitig, ob das AiC EU-Recht konform ist. Die wohl herrschende Meinung bejaht das. Die parallele Auslegung der Transparenzrichtlinie mit der Übernahmerichtlinie liegt nahe; sonst entstünden allzu große Schutzlücken, förmliche Vereinbarungen eines AiC werden sich selten einmal belegen lassen. Da die Auslegung der Transparenzrichtlinie nach Sicht des BGH für den von ihm zu entscheidenden Fall entscheidungserheblich war, führte kein Weg an der Vorlage zum EuGH vorbei. Nicht entscheidungserheblich ist eine Frage nur, wenn die Antwort auf die Frage, wie auch immer sie ausfällt, keinerlei Einfluss auf die Entscheidung des Rechtsstreits haben kann. Das verneinte der BGH.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 2/25
Drucken | Teilen