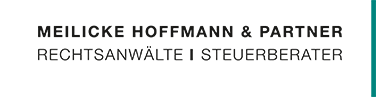Newsletter
BVerwG: Deutliche Stärkung der Kontrollmöglichkeiten zum Beispiel des Gemeinderats gegenüber Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung
Enorme Bedeutung“ (so der Kölner Rechtsanwalt Konrad Adenauer) für die Praxis zumal von Gemeinden hat eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 18. September 2024 (8 C 3/23). Sie stärkt Kontrollmöglichkeiten zB von Gemeinderäten. Denn entgegen der bisherigen Praxis setzt die Freistellung von Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft im Aufsichtsrat (AR) einer Aktiengesellschaft sitzen, von ihrer ansonsten bestehenden gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht (§ 116 Satz 2 Aktiengesetz) nicht voraus, dass die Berichtsempfänger die Vertraulichkeit der empfangenen Informationen gewährleisten müssen. Damit ist zB der Gemeinderat tauglicher Empfänger solcher Berichte der Aufsichtsratsmitglieder.
Worum geht es?
Der der Entscheidung zugrunde liegende Fall kann sich tagtäglich zB im einem Gemeinderat abspielen. Er ereignete sich in Mönchengladbach. Die lokale Presse berichtete über das Verfahren vor dem BVerwG unter der Überschrift „Fall ‚Sven‘ beschäftigt die Gerichte“ (Rheinische Post vom 18.09.2024). Zwei Fraktionen des Stadtrates (LINKE und FDP) hatten 2018 Einsicht in bestimmte Unterlagen einer Aufsichtsratssitzung einer Aktiengesellschaft (AG) verlangt. Der beklagte Oberbürgermeister (OB) war Aufsichtsratsmitglied, die Stadt an der AG mittelbar beteiligt. In der Aufsichtsratssitzung und den angeforderten Unterlagen ging es um die Frage einer rechtswidrig entstandenen Beteiligung der AG an der Entwicklung und Fertigung eines vornehmlich fürs Carsharing vorgesehenen dreisitzigen Elektrofahrzeugs SVEN („Shared Vehicle Electric Native“). Der beklagte OB lehnte den Antrag der Fraktionen ab, Einsicht in die mit der AR-Sitzung der AG im Zusammenhang stehenden Unterlagen betreffend die Kooperation von Stadt und AG zu gewähren. Begründung: die angebliche gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflicht als Aufsichtsratsmitglied.
Was steht im Gesetz?
Das ist scheinbar klar. In § 394 Aktiengesetz (AktG) ist zu lesen, dass Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in einen Aufsichtsrat gewählt oder entsandt sind, keiner Verschwiegenheitspflicht unterliegen bei Berichten, die sie ihrer Körperschaft erstatten müssen. Die Berichtspflicht kann auf Gesetz, auf Satzung oder bloßem Rechtsgeschäft beruhen. Die Vertreter der Gemeinde haben die Interessen der Gemeinde zu verfolgen und deshalb „den Rat über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten“. § 113 Absatz 5 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung (GO NRW) sieht – ebenso wie ähnliche Vorschriften der anderen Bundeslänger – eine entsprechende Berichtspflicht vor. Keine solche Berichtspflicht gibt es jedoch für Geheimnisse der Gesellschaft, wenn deren Kenntnis für den Berichtszweck bedeutungslos ist.
Der Prozess bis zum BVerwG und die Reaktionen
Gestützt auf diese Regelungen klagten die Fraktionen. Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf und Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster verurteilten den OB, den Fraktionen Einsicht in die Unterlagen zu gewähren – und zwar durch namentlich benannte Ratsmitglieder und beschränkt darauf, dass die Unterlagen keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Informationen über vertrauliche Berichte und Beratungen enthalten (Urteile vom 14. August 2020, 1 K 7000/19, und vom 12. Dezember 2022, 15 A 2689/20). Die Gerichte meinten, § 394 Aktiengesetz (AktG) suspendiere gegenüber den Fraktionen die grundsätzliche Verschwiegenheitspflicht der AR-Mitglieder nach § 116 Satz 2 AktG. § 113 Absatz 5 GO NRW schreibe zulässig die Berichtspflicht vor. Zwar steige mit einer zunehmenden Größe des zu informierenden Vertretungsorgans „die Wahrscheinlichkeit einer Relativierung der Verschwiegenheitspflicht“. Das sei jedoch im Interesse der „effektiven demokratischen Kontrolle zu akzeptieren“, lautet eine der Kern-Botschaften des OVG Münster. Zu dies in Abrede stellenden Argumenten ist in der Literatur zu lesen, es werde „ja auch nicht vertreten, die Informationsrechte mitgliederstarker Aufsichtsräte wegen ihrer notorischen Undichte einzuschränken“ (Professor Alexander Schall aus Lüneburg).
Die Reaktionen auf die Urteile waren gespalten. Große Teile der aktienrechtlichen Literatur lehnten sie ab: Der Geheimnisschutz der AG habe Vorrang vor den Interessen der Gemeinde; zwar dürfe die Zahl der Personen erweitert werden, die solche Berichte der AR-Mitglieder zu lesen bekämen; sie müssten aber zur Geheimhaltung verpflichtet sein; Fraktionen könnten ohnehin nach dem Organisationsrecht keine legitimen Berichtsempfänger sein. Anders die überwiegende Sicht der öffentlich-rechtlichen Literatur: Die begrüßt das Urteil, lehnt besondere Vertraulichkeitspflichten als ungeschriebene Voraussetzung der Berichterstattung ab und sieht das Urteil als Schritt zur Stärkung des gemeindlichen Selbstorganisationsrechts.
Die Entscheidung des BVerwG
Das BVerwG billigt in seinem Urteil die Entscheidungen von VG und OVG und verstärkt noch deren Argumentation: Berichtspflichten von AR-Mitgliedern gegenüber der Gebietskörperschaft verlangten keine Gewährleistung eines besonderen Maßes an Vertraulichkeit; der Rat einer Gemeinde könne Berichtsempfänger sein, das sei nicht etwa wegen seiner Größe ausgeschlossen; Entstehungsgeschichte sowie Zweck, Wortlaut und Systematik ständen der Berichtspflicht gegenüber dem Rat nicht entgegen. Entscheidend ist nach dem BVerwG vielmehr Folgendes: Die im Aktiengesetz durch § 394 ermöglichte Berichtspflicht gegenüber der Gebietskörperschaft bezwecke die Regelung der Pflichtenkollision zwischen der gesellschaftsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht der AR-Mitglieder einerseits und andererseits dem öffentlichen Interesse der Gebietskörperschaft an einer effektiven Beteiligungsverwaltung; das gesetzliche Regelungsziel effektiver Verwaltung und Prüfung öffentlicher Beteiligungen im Interesse der Gebietskörperschaft umfasse „die Wahrnehmung demokratischer Kontrolle durch das zuständige Gemeindeorgan“; die sei nur gewährleistet, „wenn dem zuständigen Kontrollorgan die nötigen Informationen zur Verfügung gestellt werden“. Andernfalls käme das durch das Gesetz anerkannte Informationsinteresse der Gebietskörperschaft nicht ausreichend zur Geltung.
Das BVerwG unterstreicht: Das öffentliche Kontrollinteresse hat Vorrang vor allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Vertraulichkeitsgrundsätzen. Auch bei der Beteiligung an privaten Unternehmensformen unterliege die öffentliche Hand demokratischer Kontrolle. Deren effektive Wahrnehmung ist nach dem BVerwG nur gewährleistet, wenn das zuständige Kontrollorgan die nötigen Informationen erhält. Die demokratische Kontrollfunktion spiele nicht nur im Verhältnis von Parlament und Regierung eine maßgebende Rolle, sondern auch auf kommunaler Ebene. Das folge aus Art. 28 Abs. 1 Grundgesetz (GG). Danach muss die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen Rechtsstaates entsprechen.
Einordnung der Entscheidung des BVerwG
Wie nicht anders zu erwarten, geht die rechtswissenschaftliche Diskussion munter weiter. In der Literatur gibt es bislang nur einen deutlichen Befürworter – den eingangs erwähnten Rechtsanwalt Adenauer aus Köln: Das BVerwG stärke „die Demokratie und das Prinzip von Checks and Balances auf kommunaler Ebene“; in einen Aufsichtsrat entsandte Ratsmitglieder müssten ihr Wissen mit dem Aufsichtsrat nicht angehörenden Ratsmitgliedern teilen. Adenauer nennt ein Beispiel: „Personalentscheidungen im Geheimen, dh ohne vorherige Rückkopplung mit dem politisch und demokratisch verantwortlichen Rat, … sollten damit endgültig der Vergangenheit angehören“. Die Gemeinden müssten die Berichte im nicht-öffentlichen Teil von Gemeinderatssitzungen oder in Ausschüssen erörtern können.
Andere Stimmen sind deutlich verhaltener: Man kann aus der Feder von Wissenschaftlern lesen von der „weitherzigen Interpretation des Berichtsanspruchs“ (so der Freiburger Professor Jan Lieder und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Nikolai Stüttgen). Erklärtermaßen unternehmensnahe Sichtweisen gehen weiter: Das Urteil sei „verfehlt“, ein Gemeinderat sei „in aller Regel ungeeignet“ für die Wahrung der Vertraulichkeit, das BVerwG „gefährdet Vertraulichkeit des Aufsichtsrats sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat“, betroffene Unternehmen müssten künftig vertrauliche Inhalte nach Maßgabe des Umfangs der Berichtspflicht prüfen „unter Würdigung der Frage, welche Dokumente und Informationen für Zwecke der Berichterstattung von Bedeutung“ seien; bereits im Vorfeld von AR-Sitzungen empfehle sich eine Differenzierung und Kennzeichnung der Beratungsinhalte (RAe Benjamin Weber und Micha Brechtel).
Klar scheint: Das Urteil stärkt deutlich die Kontrollmöglichkeiten des Gemeinderats und seiner Mitglieder sowie Fraktionen über Unternehmen mit Beteiligung von Gebietskörperschaften durch Berichterstattung ihrer AR-Mitglieder. Informationen über Berichte der auf Veranlassung der Körperschaft entsandten oder gewählten AR-Mitglieder wird man dem Gemeinderat kaum einmal vorenthalten können. Die einzige Ausnahme der Informationspflicht nach § 394 AktG: Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Beteiligungsgesellschaft sind im Grundsatz geschützt – wenn ihre Kenntnis nicht ausnahmsweise einmal für die Zwecke der Berichte der AR-Mitglieder an ihre Gebietskörperschaft von Bedeutung ist. Der oben angesprochenen unternehmensnahen Sichtweise, Gesellschaften sollten AR-Mitglieder nur noch selektiv informieren, steht das Prinzip entgegen, dass alle AR-Mitglieder gleich zu behandeln sind; jedes AR-Mitglied kann nämlich verlangen, dass der gesamte AR über Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichtet wird. Zu einer Informationsbeschränkung besteht angesichts des durch § 394 AktG garantieren Geheimnisschutzes auch gegenüber der Gebietskörperschaft überhaupt keine Veranlassung.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 3/25
Drucken | Teilen