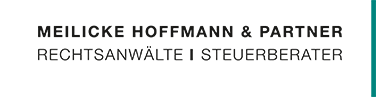Newsletter
BGH: Haftung für Anlegerschäden auch, wenn Unternehmen nicht selbst auftrat
Wichtige Pflöcke eingerammt hat jüngst der BGH für die Haftung von Unternehmen am Bespiel eines Finanzdienstleistungskonzerns, der ein betrügerischen Schneeballsystem betrieb (Urteil vom 6. März 2025, III ZR 137/24). Für die Schädigung der Anleger haften nicht nur die aktiv nach außen auftretenden Unternehmen. Alle am System beteiligten Unternehmen können haften – auch die, die nicht aktiv nach außen in Erscheinung treten. Das kann über den konkreten Fall hinaus in vielen Fällen Anlegern Hoffnung auf die Durchsetzung von Ersatzansprüchen machen.
Worum ging es im Fall?
Der Sachverhalt ist nur auf den ersten Blick etwas komplex. Er geht um Schadensersatzansprüche von geschädigten Anlegern im Konzern eines Finanzdienstleisters. Wie sich aus dem BGH-Urteil ergibt, handelt es sich dabei offenbar um den sog. Infinus-Konzern. Anleger waren offenbar insgesamt um ca. 290 € Millionen betrogen worden. Der Finanzdienstleister war seit den 2000er-Jahren aktiv. Geschäftsmodell war, langfristige Lebensversicherungspolicen auf einem Zweitmarkt zu kaufen und weiterzuführen, um am Ende der Vertragslaufzeit die Versicherungsleistung zu vereinnahmen. Zentrale Gesellschaft war eine F. KGaA. Die gab Orderschuldverschreibungen aus und vertrieb diese durch andere Unternehmen der Gruppe an ein breites Anlegerpublikum. Ende 2007 beendete die F das Geschäft am Zweitmarkt. Dennoch betrieb man u.a. das Geschäft mit den Orderschuldverschreibungen weiter, zumal mangels anderer Ertragsquellen. Die laufenden Kosten waren zu decken, die Zinsen für die bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen zu zahlen. Persönlich haftender Gesellschafter der F war J.B. Der war in Personalunion u.a. auch Vorstand einer P.AG. P war in den F-Konzern am Rande eingebunden; mit dem Geschäft, das Anlass der Klage war, hatte sie nichts unmittelbar zu tun. Ps Aufgabe im Konzern war, Verträge der F. zu vermitteln. Provisionen hatte sie absprachegemäß an die konzernangehörige I.AG weiterzuleiten. Die musste ihren Gewinn aufgrund eines entsprechenden Vertrags an F abführen. J. B. hatte erkannt, dass die F-Gruppe zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs ständig Kapital einwerben musste und dass praktisch jede Unterbrechung der Zufuhr frischen Geldes das System zusammenbrechen lassen würde. Das setzten die Beteiligten um. Landläufig nennt man so was „Schneeballsystem". Nach den gerichtlichen Feststellungen wusste J.B. insbesondere, dass das Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig war, dass die Anleger über die wirkliche Ertrags- und Finanzlage falsch informiert wurden und dass F. kein nachhaltiges Geschäftsmodell mehr betrieb, sondern dies prospektwidrig war.
Der Kläger erwarb 2011 von F Orderschuldverschreibungen i.H.v. 100.000 €. Er erhielt darauf Auszahlungen von nur ca. 5.000 €. Mittlerweile ist gegen F, P und I das Insolvenzverfahren eröffnet. J.B. und diverse Mittäter aus dem Kreis der Gruppe sind rechtskräftig verurteilt u.a. wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und Kapitalanlagebetrugs (vgl. Strafurteil des LG Dresden 09.07.2018, 5 KLs 100 Js 7387/12; Revision weitgehend verworfen durch BGH-Urteil vom 29.10.2021, 5 StR 443/19). J.B. und seine Mittäter sowie P traten nicht selbst gegenüber den geschädigten Anlegern auf; das machten gutgläubige Anlagevermittler; in Verkaufsschulungen wurden denen die wahren wirtschaftlichen Hintergründe verschleiert. Der Kläger verlangte von P als Schadensersatz die Differenz von ca. 95.000 €. Da Ps Insolvenzverwalter ablehnte zu zahlen, meldete der Kläger seine Schadensersatzforderung gegen P zur Insolvenztabelle an. Er meint, die P hafte ihm schon deshalb, weil sie sich in das betrügerische Schneeballsystem der F-Gruppe mit Wissen und Wollen ihres rechtskräftig verurteilten Vorstands J.B. habe einbinden lassen; das habe die eigentliche Täuschungshandlung der F. ihm gegenüber überhaupt erst ermöglicht, zumindest aber wesentlich erleichtert.
Das LG Dresden (Urteil vom 23. Dezember 2022, 9 O 2597/21) hatte die Klage abgewiesen, das OLG Dresden (Urteil vom 28. Februar 2024, 13 U 113/23) ihr stattgegeben.
Der Inhalt der Entscheidung des BGB
Die Revision der P (bzw. ihres Insolvenzverwalters) hatte vor dem BGH keinen Erfolg (Urteil vom 6. März 2025, III ZR 137/24). Der bestätigte nicht nur die Sicht des Oberlandesgerichts. Sondern er nahm den Fall zu Anlass für wegweisende Aussagen weit über den konkreten Anlass hinaus:
Haftung des Vereins für seine Organe
Eine juristische Person wie die Aktiengesellschaft hafte, wenn eines ihrer Organe (wie im entschiedenen Fall der J.B.) in amtlicher Eigenschaft eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung begangen habe. Die „amtliche“ Eigenschaft – das ist der zB dem Vorstand oder Geschäftsführer zugewiesene Wirkungskreis. Das regelt § 31 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) für den Verein; es gilt aber genauso zB auch für Aktiengesellschaften, GmbHs sowie Personengesellschaften. Die Aussage lässt sich unmittelbar aus dem § 31 BGB ableiten.
Relative Ferne der am Schnellballsystem beteiligten Gesellschaft unbeachtlich
Dabei konnte der BGH aber nicht stehen bleiben. Denn Vertragspartner des Klägers war ja nicht die P AG. Nach dem Urteil hatte die P mit dem Geschäft des Klägers und seinem Schaden unmittelbar nichts zu tun. Sie war „nur“ in einer Nebenrolle als Vermittlerin in das Unternehmensgeflecht des F-Konzerns eingebunden. Und da setzt der BGH an. Im Leitsatz schreibt er: „Sind Organe verschiedener juristischer Personen mit ein und derselben natürlichen Person besetzt und hat diese eine schadenstiftende unerlaubte Handlung in unterschiedlichen ‚amtlichen‘ Eigenschaften begangen, haften … für den eingetretenen Schaden alle juristischen Personen, für die sie … als Organ im … zugewiesenen Wirkungskreis aufgetreten ist, als Gesamtschuldner“. Die der Ersatzpflicht zugrunde liegenden Rechtsnormen sind § 830 Abs. 1 BGB und § 840 Abs. 1 BGB: Danach gilt, dass wenn mehrere durch ein gemeinschaftlich begangenes Delikt einen Schaden verursachen, jeder für den Gesamtschaden verantwortlich ist – was selbst dann gilt, wenn nicht festzustellen ist, welcher von den mehreren Beteiligten den Schaden durch seine eigene Handlung verursacht hat. Haftungsbegründend können sogar berufstypische, für sich genommen neutrale Handlungen sein, wenn die handelnde natürliche Person weiß, dass sie so zB eine strafbare Handlung fördert – maW zu ihr Beihilfe leistet. In solchen Fällen haften die Beteiligten als Gesamtschuldner, d.h. der Geschädigte kann von jedem Beteiligten den Ersatz des gesamten Schadens verlangen. Dabei ist grundsätzlich gleichgültig, wie hoch der eigene Beitrag an der Schädigung ist. Unterschiedlich schwerwiegende Tatbeiträge können später intern zwischen den Tätern in einem „Gesamtschuldnerinnenausgleich“ gem. § 426 BGB auszugleichen sein.
Die Voraussetzung dieser Haftungsnormen bejaht der BGH für die P. Das Handeln ein und desselben Menschen (in der BGH-Diktion „natürlichen Person“) könne mehreren juristischen Personen zuzurechnen sein, wenn er ein aus mehreren Teilakten bzw. Tatbeiträgen bestehendes Delikt in unterschiedlichen Organfunktionen begangen habe – also zB einzelne Tatbeiträge des Delikts geleistet hat als Organmitglied in Vertretung der juristischen Person A, weitere Beiträge für die juristische B und noch weitere für C etc. Daher können nach dem BGH mehrere juristische Personen für das Handeln ihres personenidentischen Organmitglieds zum Schadensersatz verpflichtet sein.
Nach der für den BGH maßgebenden Sicht eines objektiven Betrachters ist bei einem Schneeballsystem jeder von den Beteiligten begangene Tatbeitrag schadensrelevant; dass das an unterschiedlichen Positionen des Systems geschieht, hält der BGH für unbeachtlich. Daher kommt es nicht nur zur Haftung von J.B. und F, u.a. als Verantwortliche für die Erstellung des unrichtigen Prospekts sowie Organisation und Vertrieb der Orderschuldverschreibungen. Auch die dem eigentlichen Geschehen fernstehende P haftet nach dem BGH: Denn die war im Unternehmensgefüge dazu eingesetzt, als Vermittlerin das Provisionskarussell am Laufen zu halten mit dem Ziel, unrichtig ein positives wirtschaftliches Bild der Unternehmensgruppe vorzuspiegeln. Wie hoch der Beitrag der P an der Schädigung des Klägers tatsächlich ist, ist für deren Haftung im Verhältnis zum Kläger irrelevant. Die Beurteilung dieser Frage spielt lediglich für den Innenausgleich der diversen Tatbeteiligten eine Rolle (§ 426 BGB, s. oben), mindert aber nicht den Anspruch auf vollen Schadensausgleich des Klägers gegen die P.
Die Haftung der juristischen Person hängt nach dem BGH nicht davon ab, dass diese oder deren Organ gegenüber dem Geschädigten beim konkreten Geschäft nach außen in Erscheinung getreten ist. Auch sogenannte „mittelbare Täterschaft“ könne Ersatzpflichten der juristischen Person begründen. Dass F und J.B. die geschädigten Anleger durch gutgläubige Vermittler geworben haben, schließe die Haftung der am Schnellballsystem beteiligten P nicht aus. Für die Haftung der P genügte es nach dem BGH, dass ihr Vorstand J.B. sie zum Bestandteil des planmäßig betriebenen Schneeballsystems gemacht hatte, sie dabei in nennenswertem Umfang Provisionen einspielte und (mittelbar) an F weiterleitete und dass so die Täuschung der Anleger über für ihre Anlageentscheidung maßgebliche Umstände ermöglicht wurde; dass das Schneeballsystem möglicherweise auch ohne Einbeziehung von P funktioniert hätte, ist für den BGH belanglos.
Schaden schon durch Eingehung der Beteiligung
Über den Fall hinaus von großer Bedeutung sind auch Aussagen des BGH dazu, ob dem Kläger tatsächlich ein Schaden entstanden ist, ob die Beteiligung vielleicht doch ein bisschen werthaltig war und nicht vielleicht weitere Entwicklungen abzuwarten sind – ob zB doch noch Zahlungen von F zu erwarten sind. Einmal mehr betont der BGH, dass bei Verletzung von Aufklärungspflichten oder gar Betrug im Zusammenhang mit Vermögensanlagen der Schaden in voller Höhe der Anlagesumme bereits dadurch entstehe, „dass sich der Anleger überhaupt zu der Investition entschließt“ – wie man vielleicht korrekter formulieren möchte, dass der Anleger die Investition eingeht. Dabei ist nach dem BGH gleichgültig, ob die Anlage gänzlich wertlos ist oder nur teilweise hinter der vertraglich geschuldeten Werthaltigkeit zurückbleibt. Spätere Entwicklungen berühren nach dem BGH den eingetretenen Schaden nicht; nur im Rahmen der Schadensabwicklung muss der Geschädigte Zug um Zug gegen Rückerstattung seiner Investition durch die Schädiger (abzgl. bereits erhaltener Teilrückzahlungen) mögliche weitere Erträge aus der Anlage an die Schadensersatzpflichtigen abtreten.
Einordnung der Entscheidung
Die Entscheidung des BGH ist zum einen ein wichtiger Schritt für mehr Anlegerschutz, wenn wie im Falle von Schneeballsystemen mehrere Beteiligte auftreten: Nicht nur die unmittelbar Handelnden und ihre Unternehmen müssen ggf. haften, sondern auch Hintermänner und Beteiligte, die dem eigentlichen Tatgeschehen einer Schädigung und deren Verursachung auf den ersten Blick relativ fern stehen. Zum anderen zeigt die Entscheidung ganz allgemein Wege auf, wie Geschädigte auch in anderen Konstellationen vielleicht doch zu ihrem Geld kommen können, wenn sie sich einem komplexen Gefüge gegenübersehen, das zu ihrer Schädigung geführt hat. Auch geringfügige Beiträge einzelner Tatbeteiligter können eine Haftung auslösen. Das zu bedenken ist häufig dann wichtig, wenn bei den primär Handelnden mangels Masse nichts zu holen ist.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 3/25
Drucken | Teilen