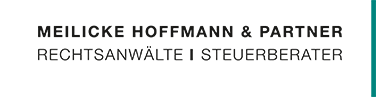Aktuelle Beiträge von Dr. Thomas Heidel
Wichtige Pflöcke eingerammt hat jüngst der BGH für die Haftung von Unternehmen am Bespiel eines Finanzdienstleistungskonzerns, der ein betrügerischen Schneeballsystem betrieb (Urteil vom 6. März 2025, III ZR 137/24). Für die Schädigung der Anleger haften nicht nur die aktiv nach außen auftretenden Unternehmen. Alle am System beteiligten Unternehmen können haften – auch die, die nicht aktiv nach außen in Erscheinung treten. Das kann über den konkreten Fall hinaus in vielen Fällen Anlegern Hoffnung auf die Durchsetzung von Ersatzansprüchen machen.
„Enorme Bedeutung“ (so der Kölner Rechtsanwalt Konrad Adenauer) für die Praxis zumal von Gemeinden hat eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 18. September 2024 (8 C 3/23). Sie stärkt Kontrollmöglichkeiten zB von Gemeinderäten. Denn entgegen der bisherigen Praxis setzt die Freistellung von Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft im Aufsichtsrat (AR) einer Aktiengesellschaft sitzen, von ihrer ansonsten bestehenden gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht (§ 116 Satz 2 Aktiengesetz) nicht voraus, dass die Berichtsempfänger die Vertraulichkeit der empfangenen Informationen gewährleisten müssen. Damit ist zB der Gemeinderat tauglicher Empfänger solcher Berichte der Aufsichtsratsmitglieder.
Immer wieder gibt es Streit um die Frage eines Stimmverbots wegen eines sog. „Acting in Concert“ (AiC)– einem Vorgehen von Aktionären, die selbst oder deren Tochterunternehmen ihr Verhalten gegenüber der Aktiengesellschaft aufgrund einer Vereinbarung „oder in sonstiger Weise“ abstimmen. Ist das so, werden nach § 34 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dem wegen der Überschreitung von Meldegrenzen (ab drei Prozent Beteiligung) meldepflichtigen Aktionär auch die Stimmrechte des Dritten zugerechnet. Meldet er seine Beteiligung nicht, unterliegt er einem umfassenden Rechtsverlust. Die Einordnung als AiC ist relativ klar, wenn es die entsprechende ausdrückliche Vereinbarung gibt. Doch kompliziert wird’s, wenn sich die Frage stellt, ob sich die Beteiligten „in sonstiger Weise“ abstimmen. Und juristisch stellt sich dann die weitere, noch grundsätzliche Frage, ob die deutsche Regelung zur „sonstigen“ Verhaltensabstimmung mit dem höherrangigen Europäischen Recht vereinbar ist. Die Entscheidung dieser Frage hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Dem steht ein Auslegungsmonopol zu.